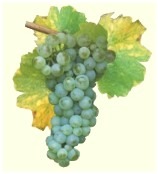|
|
 |
 |
|
In der Champagne wird bereits seit dem 4. Jahrhundert Wein angebaut. Aufgrund der privilegierten Lage im Herzen Europas entwickelte sich die Champagne im frühen Mittelalter schnell zu einem pulsierenden Handelszentrum. Die hochwertigen Weine der Region erlangten dadurch auch über Frankreichs Grenzen hinaus einen guten Ruf.
|
 |
 |
|
In den europäischen Adelshäusern erfreute sich der Wein größter Beliebtheit. Louis XIV. machte ihn zu seinem Hauswein und leitete damit einen Trend ein. Doch bis etwa 1650 handelte es sich in der Regel immer um stille Weine. Die Engländer waren es, welche das Moussieren des Weines forcierten. Es entwickelte sich zu einer Gepflogenheit, den Wein mittels Zimt, Nelken, Zucker und Melasse lebendig und perlend zu machen Die Einwohner der Champagne wären nie auf die Idee gekommen, ihren Weinen solch seltsame Zutaten hinzuzufügen.
|
 |
 |
|
Im 17. Jahrhundert schließlich sollten Benediktinermönche wie Dom Pérignon und Frére Jean Oudart die Methoden der Champagnerherstellung entscheidend verbessern. Ursprünglich wollte Dom Périg-
|
|
|
 |
gnon vor allem, dem Wein aus der Champagne durch gekonnte Traubenverschnitte eine einzigartige Qualität zu verleihen. Dabei ging es Dom Pérignon und seinen Zeitgenossen anfangs sicher gar nicht darum, dem Wein prickelnde Perlen zu verleihen. Eher irritierte ihn das leichte Perlen, das er in seiner Funktion als Kellermeister bei einigen Weinen beobachtete und als Makel empfand. Die feinen und ursprünglich unerwünschten Bläschen dürften das Ergebnis eines natürlichen Prozesses gewesen sein, der durch das kühle und raue Klima der
|
|
 |
Champagne sowie die kurze Vegetationsperiode für den Wein mitbestimmt wurde.
|
 |
 |
|
Nachdem die Trauben oft spät im Jahr gepflückt wurden, blieb den in den gepressten Trauben ent- haltenen Hefen nicht genug Zeit, den vorhandenen Zucker vollständig in Alkohol umzuwandeln. Die kühlen Wintertemperaturen brachten den Fermentationsvorgang für einige Wochen zum Erliegen. Erst mit den wärmeren Temperaturen des Frühlings kam dann die Gärung in der Flasche ein zweites Mal in Gang. Das bei diesem Prozess entstehende Kohlendioxid sammelte sich in der fest verschlos- senen Flasche und sorgte für das entscheidende Kribbeln. Das versehentliche Abfüllen unfertigen Weines ab ca. 1730, um sogenannte „schäumende Weine“ herzustellen, wurde in der Folge zu einer regelrechten Kunst entwickelt und immer weiter verfeinert. Dem Siegeszug des edlen Tropfens sollte sich fortan niemand mehr in den Weg stellen können. Das zunächst nur in Adelskreisen verbreitete Getränk eroberte rasch die Gunst zahlreicher Künstler und Intellektueller wie Voltaire oder Goethe, mit steigender Verbreitung dann auch das gehobene Bürgertum. Reichskanzler Bismarck wurde genau wie Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. ein ausgesprochenes Faible für den Champagner nachgesagt. Winston Churchill wird mit den Worten zitiert: „Bei Siegen hat man ihn verdient, bei Niederlagen braucht man ihn."
|
 |
 |
 |
|
Noch im 19.Jahrhundert wurde das Wort "Champagner" als Gattungsname für Schaumweine und Sekt beliebiger Herkunft verwendet. 1903 wurde das Gebiet, in dem der Name verwendet werden darf, eingegrenzt. Seit 1919 darf die Bezeichnung "Champagner" nur für Sekt und Schaumwein aus der Region der Champagne verwendet werden.
|
|
|
Ihren Beitrag zum Erfolg des Champagners leisteten auch eine Reihe deutscher Familien wie Roederer, Bollinger, Heidsiek, Krug oder Mumm, die vor allem aus den rheinischen Anbaugebieten in die Champagne kamen. Produzierte man 1785 erst 300.000 Flaschen, waren es 1910 schon 40 Millionen. Bis zum Ende der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts stieg die Produktion gar auf 200 Millionen Flaschen an. Die erfolgsverwöhnten Champagnerproduzenten mussten aufgrund der hohen Produktionsmengen jedoch gewaltige Mengen an Trauben hinzu- kaufen. Die Preise für Trauben aus der Champagne stiegen dadurch deutlich und lagen um ein Mehrfaches höher als die für Trauben aus anderen typischen Weinanbauländern wie Italien oder Spanien. Mit dem Traubenpreis stieg auch der Preis für die einzelne Flasche Champa- gner. Dazu beschnitt die herannahende Rezession die finanziellen Möglichkei- ten so manchen Champagner-Liebhabers. Der zwischen 1989 und 1992 eklatant sichtbar werdende Einbruch beim Champagnerabsatz war deshalb fast vorauszusehen. Bedingt durch diese Krise gerieten zahlreiche renommierte Hersteller in Bedrän- gnis und wurden von einigen großen Konzernen aufgekauft. Zu den selbstständig gebliebenen Häusern mit Weltruf gehören Bollinger, Pol-Roger oder Roederer.
|
|
|
|
 |
 |
|
Inzwischen hat man sich von der Krise ein wenig erholt und die Champagnerproduktion erreichte eine neuerliche Rekordmarke. Doch einiges hat sich verändert: So haben geschäftstüchtige Anbieter es verstanden, in Zeiten weniger prall gefüllter Geldbörsen einen preisgünstigen „Supermarkt-Champagner", den so genannten „Premier Prix", zu etablieren, der sich hartnäckig am Markt hält. Dem Verbraucher scheint es wichtiger zu sein, sich überhaupt Champagner leisten zu können. Da kommt die Flasche unter 15 Euro aus dem Supermarktregal gerade recht – auch wenn sie natürlich nicht ganz die Qualität eines Champagners für 40, 50 oder mehr Euro erreicht. In Deutschland hat dieser Billig-Champagner in kürzester Zeit Marktanteile von rund 30 Prozent erobern können. Den renommierten Marken gefällt dies genauso wenig, wie die hohen Traubenpreise, welche die nordfranzösischen Winzer verlangen. Es benötigte schon den guten Willen der Weinbauern, um den Traubenpreis 1999 auf dem nicht gerade niedrigen Level von circa 4 Euro pro Kilogramm einzufrieren.
Nichtsdestoweniger haben aber auch absolut edle Champagnersorten noch ihre Berechtigung. Am begehrtesten sind hier zweifellos die mit einem Jahrgang, auch Millesimes genannt. Sie zeichen sich durch ein individuelles Bouquet aus, das stärker an Wein erinnert. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala der echten Kenner stehen die Champagnersorten, die nur aus den am höchsten kultivierten Trauben eines Jahrganges gekeltert wurden. Zu diesen „Cuvées de Prestige" zählen beispielsweise Moets „Dom Pérignon", Roederers „Cristal", Abel Lepitres „"Prince André de Bourbon Parme" und natürlich Perrier-Jouets „Belle Epoque".
|
|
|